Leben in der Klimakrise

Vieles ist ungleich verteilt auf dieser Welt. Das Wasser auch. Und damit wird es nicht besser: hier Überschwemmung. Da Dürre. Dann umgekehrt. Und immer extremer. Längst geht es nicht mehr nur um die Begrenzung der Klimakatastrophe, sondern darum, wie wir in ihr überleben. Die Zusammenhänge sind hierbei oft komplexer als gedacht; teils sogar widersprüchlich. Permanent müssen wir unser Verhalten prüfen und anpassen. Ein Blick auf das Leben mit Wetter und Wasser, das vom Himmel kommt – oder auch nicht.
Bei all den Schwierigkeiten dieser Zeiten – das Gute vorweg; eine Sache nämlich, die alle Ansässigen eher dürregeplagter Regionen wie etwa Brandenburg und Berlin recht uneingeschränkt richtig machen können: Bäume gießen. Nein, es ist keine Wasserverschwendung. Ja, es ist dringend nötig, weil wir damit unseren eigenen Lebensraum sichern. Und ganz nebenbei kann frau* hierbei auf Nachbarn treffen, sich austauschen, soziale Bindungen und gesellschaftliche Verbindlichkeiten stärken.
Aber nun erst einmal zu den Gründen und Widersprüchen, die Menschen bewegen, Gartenschläuche zu kaufen, vielleicht kühler, aber nicht unbedingt kürzer zu duschen, weniger Fleisch zu essen und entgegen dem vermeintlichen Trend doch lieber auf Bahn plus Carsharing zu setzen, anstatt Tesla abzufeiern.

Dürre 2018. Foto: Mimikry11 (CC, Wikimedia)
Das scheinbare Wetter- und Wasserparadox
Achtung, Verwirrung! Die Abwesenheit des Wassers darf ab sofort als Beweis für seine Anwesenheit verstanden werden – oder anders herum. Klingt paradox. Ist es in Zeiten der globalen Klimakatastrophe aber überhaupt nicht. Unter der Voraussetzung, dass man* die beiden Aussagen trennt – entweder zeitlich oder örtlich.
Sprich: Wenig Wasser an einem Ort ist die Voraussetzung für viel Wasser an einem anderen Ort. Oder: Wo es in den letzten zwei Jahren viel zu wenig regnete, sind vor Kurzem so viele Massen vom Himmel gefallen, dass jenes flüssige Element des Lebens für manche Menschen zum Ende ihrer Existenz wurde. Und dieses Ereignis ist leider keine Ausnahmesituation, sondern die neue Normalität. Extreme und anhaltende Unwetterphasen werden von langen Dürreperioden abgelöst. Sehen wir. Hören wir. Immer öfter.
Dabei gibt es insgesamt zwar nicht weniger Wolken und Wasser. Aber die Wechselhaftigkeit des Wetters verschiebt sich auf eine andere Zeitskala; alles dauert länger. Länger Regen. Länger Sonne. Und jene sich ausweitende Beständigkeit von Hochs und Tiefs bringt einen beständigen Stress mit sich, weil entweder zu wenig oder zu viel Wasser vom Himmel fällt.

Hochwasser 2021. Foto: Martin Seifert (CC, Wikimedia)
Ein müder Luftfluss, der herumschlendert, anstatt dahinzujagen
Die komplexe Mechanik hinter dieser für uns Europäer*innen untypischen Wetterstabilität ist mittlerweile bekannt und in vielen Köpfen angekommen: ein ungleich verteilter Impact des Klimawandels – zulasten stabiler, flotter Luftmassenbewegungen. Manche Regionen erwärmen sich momentan nämlich stärker als andere. In der Arktis etwa ist die durchschnittliche Temperatur dreimal schneller als im planetaren Durchschnitt gestiegen. Dadurch verringert sich die Differenz zwischen den warmen Äquatorial- und der (eben nicht mehr so) kalten Polarluft.
Dieser Temperaturkontrast ist es aber, der den berühmten Jetstream antreibt – über seine Druck-Ausgleichsbewegungen in großen Höhen (die Gradientkraft) verbunden mit der Corioliskraft: Luft bewegt sich vom Äquator zum Pol, wird dabei von der Erdrotation abgelenkt und beschleunigt. Jener Jet- oder Strahlstrom wiederum jagt dann normalerweise mit seiner hohen Geschwindigkeit das Wetter über die Kontinente – von West nach Ost.
Werden nun die Temperaturunterschiede kleiner – und mit ihnen die Druckunterschiede –, strömt erst die Luft zwischen äquatorialen Höhenhochs und polaren Höhentiefs langsamer dahin. Dann verlangsamt sich der daraus abgeleitete West-Ost-Strahlstrom. Und das wiederum geht zulasten seiner Stabilität. Wie ein Fluss, der langsam fließt, beginnt er zu mäandern – bildet weite Kurven aus. Und in diesen Kurven bleiben die wetterbestimmenden Hochs und Tiefs hängen, anstatt sich – wie sonst – relativ sportlich und beständig über den Kontinent zu bewegen.
Gut-gemeint sehnt sich nach Besser-noch-mal-nachgedacht
In Wirklichkeit sind die Zusammenhänge natürlich etwas komplizierter. Aber an dieser Stelle wird es reichen, um sowohl den krassen Frosteinbruch 2020 in Nordamerika als auch die Flutkatastrophe in Westdeutschland 2021 zu erklären oder die Dürren der vorigen Jahre. Alles träge Ausreißer eines sonst eher moderaten und schnellen Wechsels. Die Normalität kippt ins Extrem. Und nicht nur solche Wetterphänomene werfen auf den ersten Blick (scheinbare) Widersprüche auf, sondern auch der Umgang mit ihnen ist längst nicht frei von Gegensätzlichkeiten. Schauen wir uns ein paar davon an!
Da gibt es zum Beispiel die Problematik im Stadtbau. Das Mantra in urbanen Gebieten mit tendenziellem Wohnraummangel hieß bislang: nachverdichten! Sprich: bestehende Flächen bebauen, anstatt das Siedlungsgebiet zu insgesamt vergrößern. Der Gedanke dahinter mag durchaus ehrenwert sein, nämlich keine neuen Flächen am Stadtrand zu versiegeln und so mehr Freiland zu erhalten – für die Natur. Nur führt dies in den Städten selbst zu zahlreichen negativen Effekten, weil es dort zum Mangel an offenen, grünen Arealen kommt. Bei Starkregen kann das Wasser dann nicht gut versickern. Kanalisationen, Straßen, Häuser werden überflutet. Bei Sommersonnenschein dagegen erhitzt sich die Betonmasse stark und hält ihre Wärme auch über Nacht. Äußerst unpraktisch. Und sehr unangenehm.

Vollverdichtete Betonwüste, hier am Beispiel von Athen, das 2021 neue Hitzewellenrekorde riss. Photo by Sophie Dale on Unsplash
Grüne Mobilität, die Wasser frisst
So unangenehm, dass sich immer mehr Menschen Klimaanlagen zulegen werden. Diese Anlagen brauchen aber eine Menge Strom. Und unsere Energiewende ist ja nun noch längst nicht vollendet. Bedeutet: CO2-Strom für kühle Köpfe. Schlecht fürs Klima. Aber das ist doch bereits schlecht! Oh nein.
Apropos Energiewende (und damit zum nächsten Paradox): Auch Elektromobilität kann uns – obwohl sie zweifelsfrei die Zukunft ist – zum Verhängnis werden. In der neuen Tesla Gigafactory Grünheide werden nicht nur Autos, sondern auch Batterien hergestellt. Sie hat einen enormen Wasserbedarf von mindestens 372.000 Litern pro Stunde (18,2 Millionen Kubikmeter im Jahr) – und das in einer immer dürrer werdenden Region wie Brandenburg! Keine so richtig gute Idee – vor allem nicht für den Grundwasserspiegel:
Selbst nach den relativ beständigen Regenfällen von Ende 2020 bis Mitte 2021 ist der Gesamtboden durch die trockenen Vorjahre noch nicht wieder ausreichend durchfeuchtet, wie frau* im Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung sehen kann. Diese Fabrik tut also vielleicht der lokalen und globalen Wirtschaft gut, bestimmt auch der Verkehrswende – unserer regionalen Natur in Zeiten der Klimakrise aber möglicherweise nicht. Es könnte irgendwann so weit kommen, dass das Wasser schlichtweg nicht mehr reicht.

Dürremonitor des Gesamtbodens 2018. Foto: Andreas Marx (UFZ – Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, CC Wikimedia)
Wie du es richtig machst, machst du es falsch
Denn in Zukunft wird es vielleicht Felder im Umland geben, die sich kaum mehr ohne Bewässerung bewirtschaften lassen. Dafür würden wir dieses Fabrikwasser dann eher brauchen. Aber auch das Bewässern an sich … ist auf Dauer keine so feine Idee – auch wenn es dem Überleben hilft. Um es oben nutzen zu können, sinkt der Pegel im Boden immer weiter. Wir bezahlen dann nicht nur die Mobilität der Zukunft, sondern auch das Gedeihen von heute mit dem Vertrocknen von morgen.
Wo wir gerade beim Versiegen sind: Paradoxerweise ist das dürregeplagte Brandenburg teils ein recht massives Sumpfgebiet. Die darin vorkommenden Moore wiederum binden unglaubliche Mengen an Wasser und CO2. Super Sache.
Aber damit könnte es auch bald vorbei sein. Denn noch eine andere, eigentlich gegen den Klimawandel gerichtete Unternehmung macht dem Land nördlich des großen Lausitzer Gebiets Probleme: die Schließung der Braunkohleförderstätten und Befüllung ihrer Riesenlöcher. Mit dem Ende jener zweifellos dreckigen Ära hat sich die Fließgeschwindigkeit der Spree weiter verlangsamt. Denn ihr fehlt aktuell noch das aus den Tagebauen abgepumpte Grundwasser, welches sie während der Industrieperiode mit speiste. Irgendwann wird sich da ein neues Gleichgewicht einstellen. Aber momentan kommt zu diesem Mangel ein weiteres Abzwacken: Ehemalige Erdlöcher wie der Braunkohletagebau Cottbus-Nord werden über Jahre geflutet, um sich in attraktive Seen zu verwandeln – und zwar maßgeblich mit Spreewasser. Das schwächt den Fluss zusätzlich. Von ihm aber hängt die Wasserversorgung Berlins ab.
Man muss sich also überlegen, ob es aus heutiger Sicht noch sinnvoll ist, ein kleines Binnenmeer wie den Cottbusser Ostsee als Naherholungsgebiet entstehen zu lassen, aus dem dann Massen an Wasser verdunsten – oder ob man den Fokus lieber auf die hydrologische Versorgungssicherheit der Hauptstadt legt. Keine leichte Entscheidung.
Und all dies zeigt, wie ungeheuer kompliziert das Leben in der Klimakrise wird … äh, ist.

Nicht klimakrisenadäquat: Flutung des Cottbusser Tagebaus zum Ostsee. Foto: Leonhard Lenz (CC, Wikimedia)
Mach grün die Stadt und weit das Land
Nach dem Blick ins düstere So-nicht nun zu den helleren Perspektiven des So-vielleichts! Von einem Elfenbeinturm aus betrachtet scheint die Sache denkbar einfach zu sein: Man muss umbauen und besser mit dem Wasser haushalten; es speichern, verteilen, geschickt in die richtigen Wege leiten. Amen. Nicht so leicht hört sich das dann in Anbetracht von 3 bis 15-jährigen Dürren an, die uns vermutlich bevorstehen, wenn sich der Jetstream weiter abschwächt. Aber es wird gehen. Die Alternative ist ja keine Alternative. Also auf ins konkrete Krisenmanagement!
Es fängt bei den Prioritäten an: Viel Wasser verbrauchen kann mensch* dort, wo viel Wasser zur Verfügung steht. Fabriken gehören dann vielleicht doch eher an den Rhein – auch wenn wir sie in Berlin besser gebrauchen könnten (wirtschaftlich und so). Und wohin mit den Häusern? Jedenfalls nicht dahin, wo eh schon viel zu viele stehen. Im Fall von Brandenburg wäre da noch genug Platz rund um die Hauptstadt herum. Natürlich geht beim Bauen im Speckgürtel wieder Natur kaputt. Aber Städte – egal wo – dürfen angesichts der Wetterextreme nicht weiter versiegelt werden. Im Gegenteil: Man müsste sie erneut aufbrechen und noch weit mehr Grünflächen darin schaffen, um Wasser im Boden sammeln zu können. Das hilft sowohl bei Starkregen als auch bei Dürren mit anhaltend hohen Temperaturen.
Dieses relativ neue Konzept nennt sich Schwammstadt und wurde nach den verheerenden Überschwemmungen von Peking 2012 entwickelt. Dabei werden Flächen, Fassaden und Dächer bewusst begrünt, versiegelte Flächen wie Wege und Straßen dagegen wieder durchlässig gemacht, damit Niederschlagswasser vor Ort versickern kann; also gespeichert wird, anstatt durch die Kanalisation abzufließen. Ein Kernelement zum Halten der Feuchtigkeit könnten dabei sogenannte Baumrigolen sein: kies- und erdgefüllte Becken mit entsprechendem Bewuchs als Verdunstungskühler und Schattenspender. Pufferspeicher, die Wasser schnell aufnehmen und nur langsam wieder abgeben.

Entsiegeln und Begrünen ist das Motto der Zukunftsfähigkeit von Städten. Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash
Vegetationsumbau, -aufbau, -pflege
Wo wir gerade bei Bäumen sind: Nur wenige Pflanzen müssen so viel erdulden wie Stadtbäume. Sie werden zwischen Fundamenten und Versorgungsleitungen eingeklemmt, durch die Luft mit Dreck bewährt, ständig beschnitten, am Stamm mit salzigem Hundeurin gefoltert und bekommen über viel zu kleine Versickerungsflächen auch kaum Regenwasser zu trinken. Stadtbäume zu gießen, ist keine Heldentat, sondern ein sinnvoller Dienst, von dem die ganze Nachbarschaft profitiert. Das Projekt „Gieß den Kiez“ überwacht die Versorgungslage der Berliner Stadtbäume. Hier kann sich jede*r über den Status umliegender Bäume informieren, um dann mit Schlauch oder Eimer seine/ihre Pflicht zu tun, wenn die botanischen Kollegen Wasser brauchen. Tolle Sache.
Über kurz oder lang werden viele von unseren grünen Freunden aber trotzdem sterben, weil sie mit den steigenden Temperaturen schlichtweg nicht klarkommen. An sehr vielen Orten der Welt wird das passieren. Und die Menschheit kann dem nur mit Vegetationsumbau begegnen. Wir müssen zwangsläufig Arten pflanzen, die besser mit Extremen klarkommen – und zwar viele verschiedene. Unsere Forstmonokulturen werden aktuell bereits umstrukturiert, gezwungenermaßen. Denn Fichten (z. B. im Harz) sterben wie die Fliegen. Auf den traurigen, frei werdenden Flächen entsteht dann hoffentlich ein Mischwald mit leicht mediterraner Anmutung.
Aber auch europäische Felder werden nicht so bleiben, wie sie sind. Viel zu groß. Viel zu ungeschützt. Viel zu schnell ausgetrocknet. Hier heißt der Schlüssel: Agroforstwirtschaft. Dabei geht es um eine Kombination von Feld- und Baumbau; um kleinere, viel diverser genutzte Flächen. Bäume schützen vor Erosion durch Wind, liefern Schatten und fördern gleichwohl die Artenvielfalt. Lange Fruchtfolgen und nur sehr vorsichtige Bodenbearbeitung lassen Humusschichten entstehen, die wiederum Feuchtigkeit besser binden können. Und Früchte wie Linsen, die bei Trockenheit nicht gleich schlapp machen, sondern erst mal eine Pause einlegen, um später weiterzuwachen, können das Szenario abrunden. Bio-plus quasi. Weil ökologische Ansätze heutzutage eben längst nicht mehr reichen.

Grüne, offene Städte binden Wasser schnell und nachhaltig. Photo by Dhoomil Sheta on Unsplash
Sparen, sparen, sparen?
Wenn Wasserknappheit ein Phänomen ist, mit dem wir immer wieder und immer öfter leben müssen – genau wie mit Starkregen und Flutkatastrophen –, dann stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Verbrauch. Und der sollte bewusst erfolgen. Okay. Aber Deutschland spart eigentlich ganz gut. So gut, dass die auf größere Mengen ausgelegte Kanalisation (z. B. in Berlin) teils mit Frischwasser nachgespült werden muss, was dann in der Bilanz wahrscheinlich auch nicht viel besser aussieht.
Interessanter sind da schon Ansätze der Weiter- und wiederverwertung. Abwasch-, Spül-, Dusch- und Regenwasser wären beispielsweise durchaus geeignet, um das WC zu spülen (und dann ruhig kräftig). Oder: Würden wir auf der anderen Seite weniger Zeugs in der Toilette und Spüle entsorgen (ich spreche von Fetten, Speiseresten, Medikamenten, Kunststoffen und Textilien), hätten die Wasserbetriebe ein leichteres Werk. Und da Wasser bekanntermaßen ein Kreislauf ist, kann frau* Sparen auch als Weniger-verschmutzen uminterpretieren. Denn alles, was wir tun, kommt zurück – entweder mit einem Bonbon oder einer saftigen Rechnung, je nachdem.
Vom Wasserverbrauch zum Wassermanagement
Im Grunde genommen gibt es in Deutschland genug Wasser – auch jetzt noch. Das Dargebot, wie die Hydrolog*innen sagen, ist längst nicht erschöpft. Nur die Verteilung, die Verteilung! Es wird langfristig also nicht nur darum gehen müssen, wie wir Wasser sparen und speichern, sondern auch, wie wir es distribuieren. Dafür müssen sich Talsperren besser vernetzen, auf hoffentlich präzisere und langfristigere Wettervorhersagen frühzeitig reagieren – also mehr speichern oder mehr ablassen und ggf. woanders auffangen.
Möglicherweise braucht es analog zur Reform des Stromnetzes im Kontext der Energiewende auch einen Ausbau oder Umbau des Wassernetzes. In Griechenland etwa werden Inseln schon sehr lange mit Tankschiffen versorgt. Vielleicht fährt ja irgendwann bei uns die Bahn mit Wassercontainern aus den Alpen und Nordwestdeutschland nach Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Mag absurd klingen, aber wenn uns vor zwei Jahren jemand erzählt hätte, dass wir bald mit Masken durch den Supermarkt rennen, hätte sie/er wohl auch reichlich Kopfschütteln geerntet.
Offen und kreativ vorauszudenken ist also notwendiger denn je – das haben wir nun gut gelernt. Wer reagiert, ist immer im Nachteil. Hingegen: Wer proaktiv lebt, kann Ungewissheiten mit Gelassenheit begegnen. Sprich: Heute die Situation nach dem eigenen Tod zu antizipieren und so zu tun, als würde man* dann noch leben, ist ein verdammt gutes Mindset, um nicht vorher weggespült oder verbrannt zu werden. Und ja, das kann jede*n von uns treffen. Denn wo das nächste Hoch oder Tief wann und wie lange hängen bleibt – dieses Wo ist ein potenzielles Überall.

Ohne Wassermanagement wird es nicht gehen. Photo by Thomas Millot on Unsplash
Mit fluidem Weitblick – Wassersensibilität trainieren
Die Klimakrise fordert die Menschheit zur Flexibilität und Umgestaltung des gesamten Lebensraums heraus – über den eigenen Tellerrand hinaus. Und wenn wir vorhin beim Sparen waren, dann habe ich eine wichtige Sache zunächst bewusst vergessen: das virtuelle Wasser bzw. den Wasserfußabdruck von Produkten.
Denn Deutschland mag ganz gut darin sein, vor Ort sichtbares Nass zu sparen, verschwendet aber um so mehr vom unsichtbaren, in Produkten gebundenen Wasser. Eine Tasse Kaffee kostet die Welt 140 Liter. Ein T-Shirt: 2000 Liter. Ein PKW bis zu 300.000. Da sind wir wieder bei der Autofabrik – nur eben nicht bei der um die Ecke, sondern bei den vielen Betrieben auf der ganzen Welt, die uns aus den Augen sind, aber schon bald nicht mehr aus dem Sinn sein werden.
Mal um die nahe liegendste Ecke gedacht: Wenn es woanders – weit weg – Wassermangel gibt (z. B. weil zu viel verbraucht wird und zu wenig von oben nachkommt), dann kommt dieses Problem auch irgendwann vor der eigenen Haustür an. Nicht nur in Form von um ihr Leben flüchtenden Menschen; irgendwann auch in sich verknappenden Ressourcen, sich verschiebenden und vermindernden Produktionsorten und -mengen. Dann kostet das neue Handy halt irgendwann 10.000 Euro. Oder es gibt nur alle 10 Jahre eins. Nicht unrealistisch.

Die Industrie verbraucht am meisten Wasser. Weltweit. Photo by Andrey Kukharenko on Unsplash
Deine Klimakrise ist meine Klimakrise
Diesem 1st-World-Problem zuvorzukommen, ist ein schicker Ansporn – und würde viel schlimmeres Leid verhindern. Und es vor Ort zu trainieren, dabei sind wir bereits: Viele reiche Menschen wie wir (das sind in Deutschland die meisten, auch wenn sich nur die wenigsten so fühlen) üben sich ja angesichts des Klimawandels darin vorauszudenken, das Bald ins Jetzt einzupreisen. Wir sind viel besser als die vorausgegangenen Generationen, den eigenen Ort und Körper gedanklich zu verlassen, um uns selbst mit der Weltrealität abzugleichen. Genau so, wie wir versuchen, immer mehr CO2 zu vermeiden, müssen wir nun auch versuchen, uns gegen Wasserknappheit und für die Anpassung an Wetterkatastrophen einzusetzen – weltweit.
Sprich: Der Umgang mit der Klimakatastrophe ist gleichsam ihre Reduktion – und umgekehrt. Es geht nur Hand in Hand. Es geht nur im internationalen Miteinander. Und die größte Macht der Verbraucher*innen liegt nach wie vor in ihrem lokalen Konsum, der global wirkt.
Überleben in Extremen, das die neue Normalität ist, bedeutet, Wasser gut zu nutzen und in allem, was man* konsumiert, mitzudenken. Genau wie die Energie. Von der Klimakrise zur Energiewende zur Wasserwende. So einfach ist es vielleicht. Und was kommt als Nächstes? Keine Ahnung. Aber wäre die Menschheit nicht lernfähig, dann wäre sie schon längst nicht mehr da: Die Tatsache der Reise gibt Anlass zur Hoffnung auf ihre Fortsetzung. Kommt gut voran, passt euch an und auf euch auf!

Photo by Bruno Aguirre on Unsplash







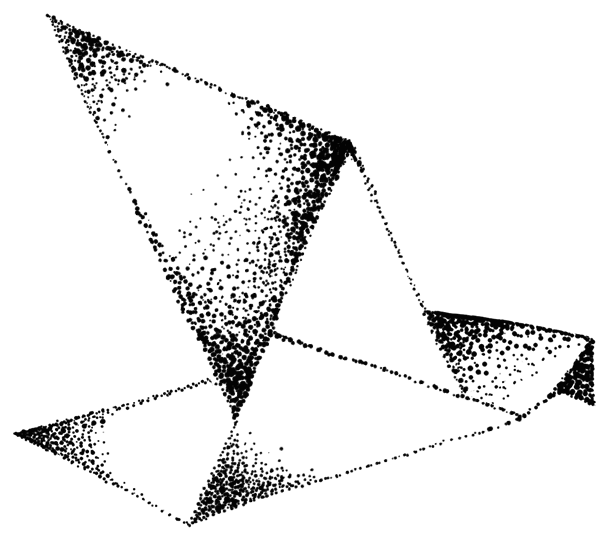
0 Kommentare