Nachhaltig am Ziel vorbei

Die Zukunft des Planeten wird aus nachhaltigen Taten gebaut. Sie freut sich riesig über unsere Versuche, es besser zu machen. Manche davon erweisen sich bei näherer Betrachtung zwar als Griff ins Klo des guten Willens. Aber das soll uns nicht entmutigen, sondern amüsieren und anregen. Zum Weiterdenken. Zum Bessermachen. Eine kleine Reise durch die Welt der versteckten Ecofails.
Wenn bei einer netten Idee hinten nichts Grünes, sondern etwas eher Braunes herauskommt, dann haben wir entweder Fehler gemacht oder nicht richtig nachgedacht. In Hinblick auf die blühenden Landschaften der Wiedervereinigung mag diese These vielleicht etwas steil sein (wenn auch nicht völlig absurd). Aber bei vielen anderen Dingen trifft sie so was von zu, dass einem der Mund aufklappt und kaum wieder zugehen will.
Das große Staunen
Da staunen Elektromobilisten über ihren CO2-Fußabdruck, Mülltrennweltmeister über das Ergebnis ihrer Anstrengungen und Trendsetter über die Schwachsinnigkeit ihrer coolen Kulturtechniken. Gut Lachen haben am Ende vor allem die Bio-Veganer – gemeinsam mit denen, die sich (wie wir hier) ihre Handlungen anschauen und versuchen, sie bewusster zu gestalten. Und nun geht es ab in die spannende Dialektik der ökologischen Aufklärung!
Ein Wolf im Waschbärenpelz
Eines der schönsten Beispiele gleich zu Anfang: die Waschnuss. Als komplett natürliches Wäschereinigungsmittel wird sie in Indien wohl schon seit Jahrtausenden verwendet, schont das Wasser und den Geldbeutel. Nicht weit vor der letzten Millenniumswende entdeckte nun unsere wachsende westliche Bioszene dieses kleine Wunder – und fing an, sie wie wild zu kaufen. Ist ja auch viel besser für die Umwelt, nicht wahr?
Nun ja, geht so. Im Ergebnis stieg der Preis dieser Nuss nämlich so stark an, dass sie sich kein Inder mehr leisten konnte. Der ganze Subkontinent war gezwungen, auf Industrieprodukte zurückzugreifen – damit wir unser Gewissen reinwaschen konnten. Nicht so nett. Zudem darf man sich fragen, ob es besonders umweltfreundlich ist, ein Produkt um den halben Globus zu transportieren. Und als Antwort gibt es mittlerweile ganz gutes, nicht so weit hergeholtes Biowaschmittel. Gefahr gebannt. Situation gerettet. So weit, so gut.
Daniel Düsentrieb und sein Fahrrad
Aber schon kommt der nächste Schlag ins Gesicht des Idealisten. Nehmen wir uns dafür ruhig mal den Autor dieses Texts vor! Ein Fahrradfahrer ist er, ganz engagiert. Will kein Auto. Nimmt von Stadt zu Stadt fast immer die Bahn, kauft bewusst Bio und so weiter. Reist aber auch in ferne Länder. Die Welt für ihn … so interessant, so schön … die arme Welt!
Fahrrad statt Auto: In den meisten Städten ist man mit dem Drahtesel besser und schneller unterwegs.
Denn mit einem richtig weiten Interkontinentalflug (hin und zurück jeweils 9.000 km) emittiert er durchschnittlich das Doppelte an CO2 (4,5 t) wie eine Person, die das ganze Jahr Auto fährt (zwei Tonnen). Und es ist mehr als der massive Fleischkonsum eines Deutschen über 48 Monate (vier Tonnen CO2). Absurderweise ist es dann aber die weltweite Tierhaltung, welche so viele Treibhausgase ausstößt wie der gesamte Verkehr auf dem Planeten. Zirkelschluss?
Nein, die Fleischesser sind gegenüber den Fernfliegern einfach nur in der Überzahl. Und ich bin sowohl als auch (womit wir bereits bei 5,5 t pro Jahr wären), wo es eigentlich beides zu vermeiden gälte. Das ist natürlich nicht leicht, wenn man sich sehr gut im Hedonismus wiederfindet. Ein halbfauler Kompromiss vielleicht: seltener fliegen, Flugmeilen kompensieren. Und natürlich weniger Fleisch essen. Aber dazu später.
Fata Morgana der schnellen Lösung
Kurzer Blick auf den Tacho: Um die Erderwärmung bis 2050 auf zwei Grad zu begrenzen, müssen wir unseren CO2-Ausstoß auf 2,3 Tonnen pro Kopf und Jahr reduzieren. In Deutschland liegt er bislang noch bei circa zehn Tonnen. Drei Viertel unserer Emissionen müssen also weg. Und da allein Autofahren fast das gesamte Jahreskontingent (zwei von 2,3 Tonnen CO2) einer Person verbraucht, lohnt es sich (nach dem Fliegen) sicher, an dieser Schraube zu drehen. Denkt sich der moderne Bürger und setzt ab sofort voll auf Elektromobilität. Leider setzt er dabei zumindest einen Teil seiner Ambitionen in den Sand.
Elektromobiler Langstreckenlauf
Denn wie bei vielen Dingen wird hier gern der berühmte ökologische Rucksack vergessen: jener Ausstoß, der allein für die Produktion anfällt. Ein Elektroauto braucht Batterien, deren Herstellung momentan noch sehr energie- und ressourcenintensiv ist. Deshalb kommt es mit durchschnittlich fünf Tonnen CO2-Emission im Gepäck auf die Welt. Doppelt so viel wie eines mit Verbrennungsmotor. Um das wieder aufzuholen, muss man erst mal ca. 50.000 Kilometer bzw. drei bis fünf Jahre damit fahren.
Auch das E-Mobil ist nicht emissionsfrei. Aber langfristig hat es eine bessere Bilanz als klassische Verbrenner.
Null Emission: eine Nullnummer
Nach dieser Zeit ist man dann aber fast immer ökologischer unterwegs als mit dem sparsamsten Diesel (Ausnahme: Tesla Model S mit 125 g CO2 / km im Strom-Mix). Geneigte Fahrer sollten allerdings beachten, dass die ganze Sache nur mit Ökostrom Sinn ergibt. Und selbst, wenn man peinlich genau darauf achtet, nichts anderes zu tanken, wird dabei zumindest ein gewisser Teil schmutzige Energie mitgetragen, solange sich das Stromnetz nicht aus 100 Prozent erneuerbaren Energien speist.
Davon abgesehen geht jedes Windrad, jede Solarzelle, jede Wasserturbine – wie alles, was wir produzieren – mit einem ökologischen Rucksack an den Start. Hier also die bittere Wahrheit: null Emission – das ist eine Milchmädchenrechnung. Gibt es nicht. Nur, wenn wir aufhören zu leben. Und das kann ein halbwegs intakter Kopf kaum wollen. Die gute Nachricht: Wer versucht, mit dem Elektroauto alles richtig zu machen, landet – über die gesamte Lebensspanne des Fahrzeugs gerechnet – immerhin bei einem Drittel der Emissionen herkömmlicher Verbrennungsmobile. Klingt doch eigentlich ganz passabel, oder? Und es wird noch besser.
Das Erstbeste ist das erste, was verbessert werden wird
Wir sind auf einem Weg, der sich windet – vor allem ökologisch – und tun möglicherweise gut daran, nicht immer unter den Early Adopters zu sein. Meist ist es ökologischer, das aktuelle Gefährt einfach weiter zu benutzen – vielleicht sogar, bis es auseinanderfällt. Dafür gibt es im Internet sogar einen praktischen Rechner.
Bei allem Enthusiasmus hängt die Energiewende ja maßgeblich vom Speicher ab. Dieser krabbelt momentan leider noch auf einem unzureichenden Entwicklungsstand herum (wie ein Baby vielleicht, das erst noch laufen lernen muss). Doch es gibt Hoffnung: Die Kapazität könnte sich bald verdreifachen. Und eine Weiterentwicklung der Superkondensator-Technologie wäre dann irgendwann genau das, was unser neues Stromzeitalter braucht.
Information frisst Strom
Apropos Energie und Technologie. Es wird ja allerorts von intelligenten Lösungen geredet, von Smart Home und IoT – und dass all diese tollen Innovationen total viel einsparen sollen, an Strom zum Beispiel. Vergessen wir dabei aber bitte nicht, wie der schon jetzt sehr hohe Energiebedarf des Internets mit der Nutzung ansteigt: mit jedem Wearable, jedem Gigabyte Cloudspeicher, jedem Online-Stream über Netflix oder Spotify – und auch mit jedem smarten Heizungsthermostat, das unterm Strich selbst mindestens so viel verbraucht, wie es vermeintlich an Energie einspart.
Es ist davon auszugehen, dass der momentane Bedarf unserer Informationsarchitektur bei mindestens fünf Prozent der weltweit erzeugten Elektrizität liegt. Tendenz: natürlich steigend. Was sonst? Das papierlose Büro ist also vielleicht doch keine so bahnbrechende Idee. Und auch bei der Digitalisierung darf man immer wieder die berühmte Aufräumfrage stellen: Brauche ich das wirklich, oder kann es weg? Denn weniger ist mehr Zukunft für den Planeten. Okay Google, Siri und Alexa, schaltet mal bitte alle Geräte aus – und Euch gleich mit!
Technologie allein wird uns nicht retten
Dass selbst energiesparende Entwicklungen gern nach hinten losgehen, weil wir Menschen einfach komisch denken, zeigt der sogenannte Rebound-Effekt. Seine Mechanik ist bedrückend primitiv: Wir rüsten unser Haus beispielsweise von Glühbirnen auf LEDs um, die natürlich viel weniger Strom verbrauchen. Um diese tolle Eigenschaft wissend, werden wir in der Folge aber nachlässig und nehmen es nicht mehr so wichtig, das Licht beim Verlassen des Raums auszuschalten. Manche lassen es vielleicht sogar grundsätzlich brennen in der Annahme, dass dies keinen großen Unterschied macht.
Am Ende sinkt der Energieverbrauch dann nicht, sondern steigt mit unter sogar an. Schade eigentlich. Deshalb sollte man jeder LED so begegnen, als wäre sie eine alte 100-Watt-Birne. Das schärft die Haltung, den Respekt vor den Dingen, ihrer Wertigkeit, ihrer Wirkung. Und es hilft.
Am Müll soll man sie messen!
Kommen wir mal zum Müll. Denn Deutschland ist ja nicht nur vermeintlicher Recyclingmeister, sondern aktuell Europas größter Erzeuger von Kunststoffverpackungen. Brav tun wir alles in unsere gelben Tonnen. Achten darauf, dass der Nachbar keine Fehler macht. Und wir freuen uns über eine Recyclingquote von über 80 Prozent – auf dem Papier. Da wird allerdings jegliche Art von Verwertung mit einbezogen, auch das mehrheitliche Müllverbrennen, weil es ja Energie erzeugt (was dann wohl als Wertumwandlung gilt). Bereinigt man die Statistik, so landen wir irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent. Und das für all die Mühe!
Vieles kann momentan tatsächlich nicht recycelt werden. Ein Grund ist der Dreck. Denn wer wirklich vorbildlich sein will, sollte seine Verpackungen vor dem Einwurf wenigstens kurz abwaschen. Ein gewisser Anteil landet aber auch noch immer im Hausmüll, der grundsätzlich nicht sortiert wird. Das kann Faulheit sein – oder ein Missverständnis. In die gelbe Tonne gehören nicht nur jene Verpackungen, die mit dem grünen Punkt gekennzeichnet sind, sondern tatsächlich alle, inklusive Dosen. Außerdem wird der äußerst unsoziale, klimafeindliche Weiterverkauf von Kunststoffmüll nach Südostasien gern unter den Tisch fallen gelassen.
Vermeiden ist besser als Sortieren
Unser Grundproblem ist aber das viele Plastik an sich, welches wir täglich einkaufen, um es dann wegzuwerfen. Dabei können Konsumenten mit Vorliebe für Bioprodukte sogar größeren Schaden anrichten als jene, denen das völlig egal ist – zumindest, wenn sie ihre Ökoware im konventionellen Supermarkt einkaufen. Dort wird Bioobst und -gemüse meist zusätzlich mit einer Kunststoffverpackung versehen, um es von den billigeren Industrieprodukten abzugrenzen.
Bio-Obst und -Gemüse, am besten aus der Region, kauft man am Besten dort, wo es nicht in Kunststoff verpackt ist – im Öko-Laden oder auf dem Markt.
Wir sollten also den vielleicht umständlicheren Weg in den Öko-Fachhandel auf uns nehmen, dort das Grünzeug nicht noch mal in Plastikbeutel packen, Käse an der Frischetheke kaufen, auf Glas- und Metallverpackungen setzen. Und es ist auch kein Fehler, die Bioläden darauf hinzuweisen, dass sie noch immer verdammt viel Kunststoff in ihren Regalen haben.
Kann denn die Antwort eine Frage sein?
Zum Schluss noch ein paar blitzlichtartige Fragezeichen, über die jeder mal selbst nachdenken darf:
Lässt sich an der so etablierten wie fragwürdigen Biogasproduktion mit ihren flächenvernichtenden Monokulturen irgendetwas Gutes finden?
Ist grünes Superfood wie Bio-Quinoa oder -Chia, das aus fernen Ländern eingeflogen wird, wirklich so super?
Sind vertikale Hydroponik-Anlagen, wo Kräuter unter künstlichem Licht wachsen, das man dann idealerweise mit Solarzellen vom Dach holt, eine sinnvolle Ergänzung zum ökologischen Anbau vor den Toren der Stadt?
Müssen wir zu Hause tatsächlich selber Dörrobst trocknen, Sachen fermentieren, Smoothies oder Joghurt herstellen, Barista spielen und die ganzen Geräte, welche dafür vonnöten sind, kaufen, anstatt jene aufwendigen Verfahren den Profis zu überlassen?
Und kann man die Welt nicht wenigstens mit veganem Katzenfutter retten?
Kritik der reinen Kritik
Solche Fragen sind wichtig, aber auch das Infragestellen geht nicht immer in die richtige Richtung. So werden biologische Lebensmittel häufig von Denkfaulen generalkritisiert, weil es da mal den einen oder anderen Skandal gab. Auch über Veganer macht man sich gern lustig, was ich hier gerade vorbildlich exerziert habe. Das ist besonders gemein, wenn es (anders als beim Katzenbeispiel) dann auch noch jeglicher Grundlage entbehrt.
Ein besonders falscher Vorwurf: Veganer würden mit ihrem Sojakonsum zur Abholzung des Regenwalds beitragen, weil die Pflanzen dafür hauptsächlich in Brasilien angebaut werden. Ja, werden sie, aber größtenteils eben nur für Fleisch. Je nach Berechungsgrundlage gehen zwischen 80 und 98 Prozent des weltweit erzeugten Sojas in die Nutztierhaltung. Wer nun aber Bio-Tofu kauft, ist zu 100 Prozent raus aus der Nummer, weil das Soja dafür meist sogar in Europa angebaut wird.
Bewusstes Leben ist komplex – aber geil
Welche Perspektive wir auch immer einnehmen – nichts ist so einfach, wie es scheint. Falsche Entwicklungen sind selten durchweg böse. Das Gute ist nie frei von Verfehlungen und die noch so scharfsinnigste Kritik anfällig für intellektuellen Selbstbetrug.
Wach, nicht bequem, engagiert, wissensgeil und offen für Kurskorrekturen sei der Mensch. Er gibt sich mit keiner Lösung zufrieden; versucht, Dinge weiter zu denken und jede noch so unangenehme Kritik mit einem Lächeln aufzunehmen. Er zieht das Sein dem Haben vor und beschränkt sich aufs Wesentlichste. Er bzw. sie versucht, zur Natur zurückzukehren bzw. natürlich zu bleiben.
Der Wille war da – und darf weiterdenken
So ein Mensch geht jetzt vielleicht mal auf diese Seite und schaut, wo er oder sie überhaupt steht und was sie oder er noch tun kann, um uns im Universum einen besseren Ruf, aber vor allem eine bessere Zukunft zu bescheren. Denn jeder Fehlversuch ist die beste Grundlage für das Gelingen des nächsten Anlaufs. Ein Spiel, das man Entwicklung nennt.






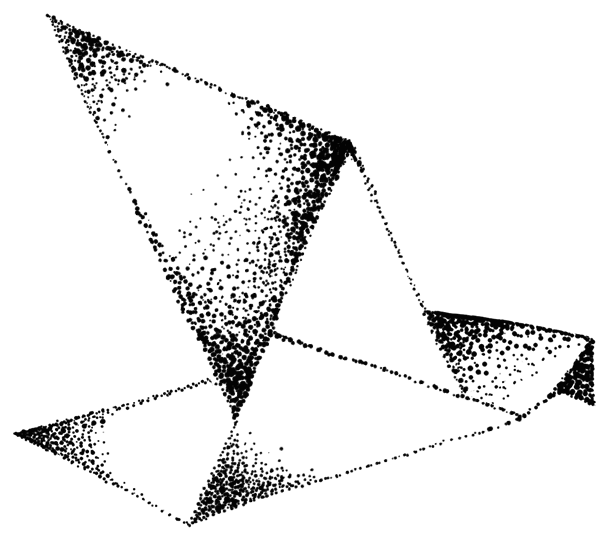
0 Kommentare